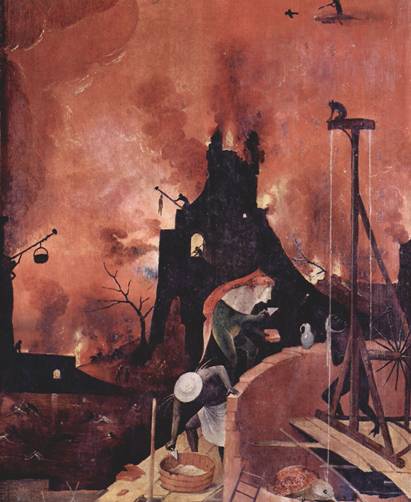Preußischer optischer Telegraf
- berlinersalon
-
 Autor
Autor
- Offline
- Platinum Mitglied
-

Weniger
Mehr
- Beiträge: 1334
- Dank erhalten: 12
02 Nov. 2011 12:10 - 02 Nov. 2011 16:51 #5735
von berlinersalon
Preußischer optischer Telegraf wurde erstellt von berlinersalon
sehr gut versteckte tatsachen:
weiterführung der technik des vorfeudalen signalsystems
auf der grundlage von vermessung und landschaftsgestaltung
Optische Telegraphie
Preußischer optischer Telegraf
Optische Telegraphie in Preußen
Turm der Dahlemer Dorfkirche in Berlin
Köln-St-Pantaleon-1832-Opt-Telegraphie
SEMAPHOREN – Signalsystem der Vorzeit
schon bosch weist auf dieses signalsystem hin
weiterführung der technik des vorfeudalen signalsystems
auf der grundlage von vermessung und landschaftsgestaltung
Optische Telegraphie
Preußischer optischer Telegraf
Optische Telegraphie in Preußen
Turm der Dahlemer Dorfkirche in Berlin
Köln-St-Pantaleon-1832-Opt-Telegraphie
SEMAPHOREN – Signalsystem der Vorzeit
schon bosch weist auf dieses signalsystem hin
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
Weniger
Mehr
- Beiträge: 1283
- Dank erhalten: 16
02 Nov. 2011 22:45 #5743
von Ingwer
Ingwer antwortete auf Aw: Preußischer optischer Telegraf
Soweit ganz interessant!
Nur Bosch meint mit diesem Teil ein anderes Signal!
Nur Bosch meint mit diesem Teil ein anderes Signal!
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
02 Nov. 2011 22:46 - 02 Nov. 2011 23:08 #5744
von Tuisto
Tuisto antwortete auf Re:Preußischer optischer Telegraf
Waren die keltischen Signalstationen (Ludrenplätze) quasi Vorläufer der optischen Telegrafen?
Gab es entlang von unübersichtlichen Flußbiegungen, wie z.B. am Rhein bei der Lorelei, deshalb soviele Burgen und Türme, um die Signale und Infos schnell um die Biegungen leiten zu können?
War womöglich ganz Europa und Nordafrika einstmals durch Signaltürme miteinander verbunden?
Gab es entlang von unübersichtlichen Flußbiegungen, wie z.B. am Rhein bei der Lorelei, deshalb soviele Burgen und Türme, um die Signale und Infos schnell um die Biegungen leiten zu können?
War womöglich ganz Europa und Nordafrika einstmals durch Signaltürme miteinander verbunden?
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
Weniger
Mehr
- Beiträge: 1283
- Dank erhalten: 16
02 Nov. 2011 22:49 #5745
von Ingwer
Ingwer antwortete auf Aw: Re:Preußischer optischer Telegraf
Kein so abwegiger Gedanke!
Denkt an die nordamerikanischen Indianer mit ihren Feuerzeichen!
Diese waren / sind auch in Europa!
Denkt an die nordamerikanischen Indianer mit ihren Feuerzeichen!
Diese waren / sind auch in Europa!
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- berlinersalon
-
 Autor
Autor
- Offline
- Platinum Mitglied
-

Weniger
Mehr
- Beiträge: 1334
- Dank erhalten: 12
03 Nov. 2011 07:53 - 03 Nov. 2011 10:02 #5747
von berlinersalon
berlinersalon antwortete auf Aw: Preußischer optischer Telegraf
Weitere Linien
Frankreich (1794), England (1796), Schweden (1794), Dänemark (1800), Russland (1802), Indien, , Ägypten (1823), Australien (Länder: Drogge 1961, Alter: Anonymus), Norwegen (1810), Finnland, Italien (1810), Österreich (1835), Brasilien, Spanien und USA (Arlt 2007c: 11).
Russland mit längster Linie
ingwer
deine sich langsam zu einer störung ausstülpende besserwisserei
ohne hinweise, gründe & argumente geht einem gelegentlich
ich bitte um nachsicht - gehörig auf die ketten
auch die hinweise auf das abbrechen
der bäuerlichen turmsysteme nach dem bauernkrieg
und die beseitigung der turmhelme in frankreich ergeben so einen sinn
auch das meßsystem poppau gewinnt dadurch an dimension
ich beginne gerade mit den neuen google earth daten
es scheint - was ich bisher sehe - genauer zu sein
auf boschs turm - wen wunderts - ein B
vielleicht deutet es ja auch auf bielefeld hin
Frankreich (1794), England (1796), Schweden (1794), Dänemark (1800), Russland (1802), Indien, , Ägypten (1823), Australien (Länder: Drogge 1961, Alter: Anonymus), Norwegen (1810), Finnland, Italien (1810), Österreich (1835), Brasilien, Spanien und USA (Arlt 2007c: 11).
Russland mit längster Linie
ingwer
deine sich langsam zu einer störung ausstülpende besserwisserei
ohne hinweise, gründe & argumente geht einem gelegentlich
ich bitte um nachsicht - gehörig auf die ketten
auch die hinweise auf das abbrechen
der bäuerlichen turmsysteme nach dem bauernkrieg
und die beseitigung der turmhelme in frankreich ergeben so einen sinn
auch das meßsystem poppau gewinnt dadurch an dimension
ich beginne gerade mit den neuen google earth daten
es scheint - was ich bisher sehe - genauer zu sein
auf boschs turm - wen wunderts - ein B
vielleicht deutet es ja auch auf bielefeld hin
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
Weniger
Mehr
- Beiträge: 1283
- Dank erhalten: 16
03 Nov. 2011 18:38 #5753
von Ingwer
Ingwer antwortete auf Aw: Preußischer optischer Telegraf
@bs,
Die "Nachsicht bekommt der "bs".
Wenn ich darauf hinweise, dass Bosch mit der Signaltechnik nichts gemein hat, dann
stört dies Deine Kreise.
Wer bedient sich dann der Besserwisserei, obwohl er den Bosch nicht einordnen kann?
Dir die Steine und die "Eisenbahnsignale" und mir die Malerei.
Jeder hat sein Fachgebiet und dabei Einsicht!
Übrigens zeigt "Bosch" die Mühle, den Halbmond, den Stein und die Kanone.
ngwer
deine sich langsam zu einer störung ausstülpende besserwisserei
ohne hinweise, gründe & argumente geht einem gelegentlich
ich bitte um nachsicht - gehörig auf die ketten
Die "Nachsicht bekommt der "bs".
Wenn ich darauf hinweise, dass Bosch mit der Signaltechnik nichts gemein hat, dann
stört dies Deine Kreise.
Wer bedient sich dann der Besserwisserei, obwohl er den Bosch nicht einordnen kann?
Dir die Steine und die "Eisenbahnsignale" und mir die Malerei.
Jeder hat sein Fachgebiet und dabei Einsicht!
Übrigens zeigt "Bosch" die Mühle, den Halbmond, den Stein und die Kanone.
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- berlinersalon
-
 Autor
Autor
- Offline
- Platinum Mitglied
-

Weniger
Mehr
- Beiträge: 1334
- Dank erhalten: 12
03 Nov. 2011 19:41 - 06 Nov. 2011 18:03 #5754
von berlinersalon
warum sollte er signaltürme mit information zeigen
ohne diese zu kennen ?
deine einsichten bitte ..
ansonsten schaffst du es nicht
mir deine eignung für kunst und forschung zu vermitteln
auch deine hochmütige tonlage
läßt wohl nichts vernünftiges erwarten
außer deine nervenden inhaltsleeren ankündigungen
berlinersalon antwortete auf Aw: Preußischer optischer Telegraf
& deutlich signaltürmeÜbrigens zeigt "Bosch" die Mühle, den Halbmond, den Stein und die Kanone.
warum sollte er signaltürme mit information zeigen
ohne diese zu kennen ?
deine einsichten bitte ..
ansonsten schaffst du es nicht
mir deine eignung für kunst und forschung zu vermitteln
auch deine hochmütige tonlage
läßt wohl nichts vernünftiges erwarten
außer deine nervenden inhaltsleeren ankündigungen
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- berlinersalon
-
 Autor
Autor
- Offline
- Platinum Mitglied
-

Weniger
Mehr
- Beiträge: 1334
- Dank erhalten: 12
06 Nov. 2011 23:28 #5765
von berlinersalon
berlinersalon antwortete auf Aw: Preußischer optischer Telegraf
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
07 Nov. 2011 09:45 - 07 Nov. 2011 10:11 #5766
von Tuisto
Tuisto antwortete auf Re:Aw: Preußischer optischer Telegraf
Wie schnell funktionierte eigentlich die Übermittlung über die gesamte Strecke?
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- berlinersalon
-
 Autor
Autor
- Offline
- Platinum Mitglied
-

Weniger
Mehr
- Beiträge: 1334
- Dank erhalten: 12
07 Nov. 2011 10:05 - 07 Nov. 2011 10:06 #5767
von berlinersalon
berlinersalon antwortete auf Aw: Re:Aw: Preußischer optischer Telegraf
hier viele interessante informationen
Durch die unterschiedlichen Stellungen der Indikatoren konnten insgesamt 4095 verschiedene Zeichen gebildet werden.
Der „entgegensehende Telegrafist“ („Spähtelegraphist“) beobachtete mit einem fest eingebauten Fernrohr (Vergrößerung 40- bis 60-fach, H.-J. PAECH nach Vortrag Arlt 2006) die Nachbarstationen, ungefähr 4 bis 5 Mal in der Minute, damit ihm von dort kein Signal entging. Wurde dort ein Signal eingestellt, diktierte der Beobachter dieses an den „Telegrafisten an der Steuerung“ („Kurbeltelegrafist“) weiter, der die Indikatoren dementsprechend einstellte. Anschließend wurde kontrolliert, ob die nächste Station richtig verstanden hatte. Jede Nachricht wurde protokolliert wodurch die Übertragungsgeschwindigkeit gemindert wurde (HJP nach Vortrag Arlt 2006).
„Die mittlere Übertragungsgeschwindigkeit betrug wohl eineinhalb Zeichen pro Minute. Bei gutem Wetter benötigte ein Signal von Berlin nach Koblenz etwa siebeneinhalb Minuten. Am 17.03.1848 war eine 30 Worte lange Depesche rund eineinhalb Stunden unterwegs.
Die beschränkte Übertragungskapazität – Schätzungen reichen von zwei bis zu freilich beachtlichen sechs Telegrammen pro Tag – mag ein Grund dafür gewesen sein, den Telegrafen ausschließlich der Staatskorrespondenz vorzubehalten. Ein Antrag der Berliner Kaufmannschaft um Freigabe der Linie für die Übermittlung von Börsenkursen und Handelsnachrichten wurde durch Kabinettsorder vom 15.04.1835 abgelehnt“ (Beyrer 1995: S. 184).
Zum Uhrenvergleich der 62 Stationen wurde alle 3 Tage einmal zu einer vollen Stunde ein Zeichen durchgegeben, das man eine Art Zeitzeichen nennen könnte. Es war die Armstellung B4, d. h. nur ein Arm war um den kleinstmöglichen Winkel (45°, aus der 180°-Position in die 135°-Position) zu schwenken.
Dieses Zeichen wurde in Berlin gegeben und lief in knapp einer Minute durch bis Koblenz. Die Berliner Zeit galt als Einheitszeit auf der Telegraphenlinie, weil alle Stationen zu diesem Zeitpunkt mit höchster Konzentration arbeiteten! Dies konnte man messen, da von Koblenz aus sofort die Kontrollmeldung zurück nach Berlin erfolgte. Die Berliner Zeit diente auf der Telegraphenlinie als Einheitszeit. Nach ihr wurden die in den Stationen genutzten Schwarzwälder Uhren mit Schlagwerk gestellt.
Bisher war die Tageszeit immer nach dem lokalen Mittagssonnenstand angegeben worden, weil beim gewöhnlichen Nachrichtenaustausch durch Boten der Zeitunterschied nicht fühlbar in Erscheinung getreten war. Nun konnte man von Berlin bis Koblenz eine kurze Meldung in wenigen Minuten durchgeben. Der Unterschied der lokalen Zeit (gemessen durch Sonnenuhren) beträgt von Ost nach West in diesem Fall aber etwa +26 Minuten. Der Schnellnachrichtenverkehr erforderte aber ein gleichzeitiges Zusammenarbeiten auf der ganzen Linie, damit z. B. die einzelnen Depeschen mit einem Zeitstempel versehen werden konnten. So kam es jetzt in Preußen zu der kulturgeschichtlichen Innovation, dass die "Berliner Zeit" als Einheitszeit auf der Linie Berlin – Koblenz eingeführt wurde (Sukkau 2010).
Eine Depesche von 30 Worten benötigte für die Durchgabe von Berlin nach Köln ~90 Minuten.
Eine Depesche von Paris nach Berlin war etwa 30 Stunden unterwegs. Sie gelangte über den französischen Telegraphen von Paris bis Metz, von dort mit Eilstafette über Saarbrücken nach Koblenz und von dort wiederum per Telegraph nach Berlin ( www.oeynhausen.com , 31.07.07).
Vermittelt wurden nur Nachrichten, die dienstlicher oder staatlicher Art waren. Sie konnten in Berlin, Köln oder Koblenz in dem Büro der Linie aufgegeben werden, aber nur von solchen Personen oder Behörden, die das Recht dazu vom König verliehen bekommen hatten.
Die Stationen konnten nur bei gutem Wetter Nachrichten weitergeben. Sie arbeiteten ca. 6 Stunden pro Tag. Versuche, auch nachts mit Hilfe von Lichtzeichen zu arbeiten, waren nicht erfolgreich genug ( www.oeynhausen.com , 31.07.07).
Durch die unterschiedlichen Stellungen der Indikatoren konnten insgesamt 4095 verschiedene Zeichen gebildet werden.
Der „entgegensehende Telegrafist“ („Spähtelegraphist“) beobachtete mit einem fest eingebauten Fernrohr (Vergrößerung 40- bis 60-fach, H.-J. PAECH nach Vortrag Arlt 2006) die Nachbarstationen, ungefähr 4 bis 5 Mal in der Minute, damit ihm von dort kein Signal entging. Wurde dort ein Signal eingestellt, diktierte der Beobachter dieses an den „Telegrafisten an der Steuerung“ („Kurbeltelegrafist“) weiter, der die Indikatoren dementsprechend einstellte. Anschließend wurde kontrolliert, ob die nächste Station richtig verstanden hatte. Jede Nachricht wurde protokolliert wodurch die Übertragungsgeschwindigkeit gemindert wurde (HJP nach Vortrag Arlt 2006).
„Die mittlere Übertragungsgeschwindigkeit betrug wohl eineinhalb Zeichen pro Minute. Bei gutem Wetter benötigte ein Signal von Berlin nach Koblenz etwa siebeneinhalb Minuten. Am 17.03.1848 war eine 30 Worte lange Depesche rund eineinhalb Stunden unterwegs.
Die beschränkte Übertragungskapazität – Schätzungen reichen von zwei bis zu freilich beachtlichen sechs Telegrammen pro Tag – mag ein Grund dafür gewesen sein, den Telegrafen ausschließlich der Staatskorrespondenz vorzubehalten. Ein Antrag der Berliner Kaufmannschaft um Freigabe der Linie für die Übermittlung von Börsenkursen und Handelsnachrichten wurde durch Kabinettsorder vom 15.04.1835 abgelehnt“ (Beyrer 1995: S. 184).
Zum Uhrenvergleich der 62 Stationen wurde alle 3 Tage einmal zu einer vollen Stunde ein Zeichen durchgegeben, das man eine Art Zeitzeichen nennen könnte. Es war die Armstellung B4, d. h. nur ein Arm war um den kleinstmöglichen Winkel (45°, aus der 180°-Position in die 135°-Position) zu schwenken.
Dieses Zeichen wurde in Berlin gegeben und lief in knapp einer Minute durch bis Koblenz. Die Berliner Zeit galt als Einheitszeit auf der Telegraphenlinie, weil alle Stationen zu diesem Zeitpunkt mit höchster Konzentration arbeiteten! Dies konnte man messen, da von Koblenz aus sofort die Kontrollmeldung zurück nach Berlin erfolgte. Die Berliner Zeit diente auf der Telegraphenlinie als Einheitszeit. Nach ihr wurden die in den Stationen genutzten Schwarzwälder Uhren mit Schlagwerk gestellt.
Bisher war die Tageszeit immer nach dem lokalen Mittagssonnenstand angegeben worden, weil beim gewöhnlichen Nachrichtenaustausch durch Boten der Zeitunterschied nicht fühlbar in Erscheinung getreten war. Nun konnte man von Berlin bis Koblenz eine kurze Meldung in wenigen Minuten durchgeben. Der Unterschied der lokalen Zeit (gemessen durch Sonnenuhren) beträgt von Ost nach West in diesem Fall aber etwa +26 Minuten. Der Schnellnachrichtenverkehr erforderte aber ein gleichzeitiges Zusammenarbeiten auf der ganzen Linie, damit z. B. die einzelnen Depeschen mit einem Zeitstempel versehen werden konnten. So kam es jetzt in Preußen zu der kulturgeschichtlichen Innovation, dass die "Berliner Zeit" als Einheitszeit auf der Linie Berlin – Koblenz eingeführt wurde (Sukkau 2010).
Eine Depesche von 30 Worten benötigte für die Durchgabe von Berlin nach Köln ~90 Minuten.
Eine Depesche von Paris nach Berlin war etwa 30 Stunden unterwegs. Sie gelangte über den französischen Telegraphen von Paris bis Metz, von dort mit Eilstafette über Saarbrücken nach Koblenz und von dort wiederum per Telegraph nach Berlin ( www.oeynhausen.com , 31.07.07).
Vermittelt wurden nur Nachrichten, die dienstlicher oder staatlicher Art waren. Sie konnten in Berlin, Köln oder Koblenz in dem Büro der Linie aufgegeben werden, aber nur von solchen Personen oder Behörden, die das Recht dazu vom König verliehen bekommen hatten.
Die Stationen konnten nur bei gutem Wetter Nachrichten weitergeben. Sie arbeiteten ca. 6 Stunden pro Tag. Versuche, auch nachts mit Hilfe von Lichtzeichen zu arbeiten, waren nicht erfolgreich genug ( www.oeynhausen.com , 31.07.07).
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.251 Sekunden